
Ein Hoch auf das Rumblödeln!
Im Laufe meiner Karriere als Industrial Designer bin ich über eine Kreativmethode gestolpert, die eigentlich jeder kennt, aber kaum jemand ernst nimmt: das Rumblödeln.
Nicht das betrunkene Rumgrölen an der Hotelbar. Sondern das echte, intelligente Blödeln. Das, bei dem man sich gegenseitig hochschaukelt, bis der Unsinn plötzlich verdächtig schlau klingt.
Die Regeln sind einfach:
- Je absurder, desto besser.
- Je plausibler der Quatsch, desto gefährlicher.
- Keine Kritik, keine Angst, kein „Ja, aber…“.
- Und vor allem: Keiner darf vorher nüchtern denken. (Innerlich!)
In einer dieser Blödelrunden gründeten wir eine Firma. Alles war geklärt:
Posten, Parkplatz, Kaffeedienst, Müllplan – alles durchdacht. Nur eine klitzekleine Frage blieb offen:
Was machen wir eigentlich?
Es dauerte etwas, aber dann:
Wir bieten für jedes Problem die schlechteste aller Lösungen.
Eine Consulting-Agentur für Katastrophen.
Großes Gelächter.
Doch je länger wir drüber nachdachten, desto weniger lustig wurde es – weil es plötzlich Sinn ergab. Mal wieder grandios gescheitert: Wir hatten versehentlich eine gute Idee.
Warum die schlechteste Lösung uns klüger macht:
1. Sie nimmt den Druck raus.
Wer nach der schlechtesten Lösung sucht, muss nicht perfekt sein. Muss gar nichts. Einfach nur: noch absurder, noch nutzloser, noch blöder. Und siehe da – plötzlich sprudeln die Ideen.
2. Sie macht mutig.
Keine Angst vor Kritik, kein Leistungsdruck. Nur Spiel. Und wer regelmäßig den kreativen Wahnsinn trainiert, entwickelt ein neues Selbstbewusstsein. Eines, das bleibt – auch wenn’s später ernst wird.
3. Sie zeigt, dass es immer Alternativen gibt.
Die meisten schlechten Ideen sind schon ganz okay. Aber richtig schlechte Ideen? Das ist hohe Kunst. Und das Gefühl, immer noch eine schlechtere (oder bessere) Lösung finden zu können, macht unheimlich frei.
Doch aufgepasst: Die schlechteste Lösung hat Nebenwirkungen.
Die ersten Ideen sind harmlos: Produkte, die nichts taugen, Dienstleistungen, die keiner will.
Dann wird’s politisch. Dann wird’s moralisch.
Was, wenn eine Puppe kleinen Mädchen Stromschläge gibt, sobald sie sie bürsten?
Was, wenn Produkte rassistisch, sexistisch oder menschenverachtend wären – aber so codiert, dass es niemanden auffällt, aber es trotzdem wirkt?
Spätestens hier wird’s unangenehm. Und das soll es auch.
Denn genau an dieser Grenze zeigt sich, wie sehr wir an unseren Überzeugungen hängen. Und wie schnell wir ins Moralische flüchten, sobald’s schmerzt.
Aber genau dort liegt der Schatz.
Die Suche nach der schlechtesten Lösung bringt die dunklen Flecken ans Licht. Sie zeigt Denkfehler, Logiklücken und versteckte Narrative. Sie enttarnt Scheinlösungen und PR-Märchen. Und sie zwingt uns, hinzusehen – selbst wenn’s weh tut.
Warum das niemand offiziell macht?
Weil sie gefährlich ist.
Weil sie Wahrheiten aufdeckt, die niemand hören will.
Weil sie zeigt, wie tief das System der „guten Lösungen“ von Denkfaulheit und Angst durchzogen ist.
Die schlechteste Lösung ist kein Partyspiel. Sie ist ein Spiegel.
Und wer mutig genug ist, hineinzusehen, erkennt oft mehr als ihm lieb ist.
Darum die goldene Flockenregel:
Wende sie erst auf fremde Probleme an. Lache. Lerne. Verstehe.
Dann vielleicht – vielleicht! – auch auf deine eigenen.
Aber nur, wenn du bereit bist, es wirklich wissen zu wollen.
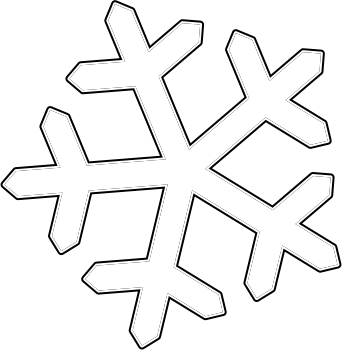
Schreibe einen Kommentar